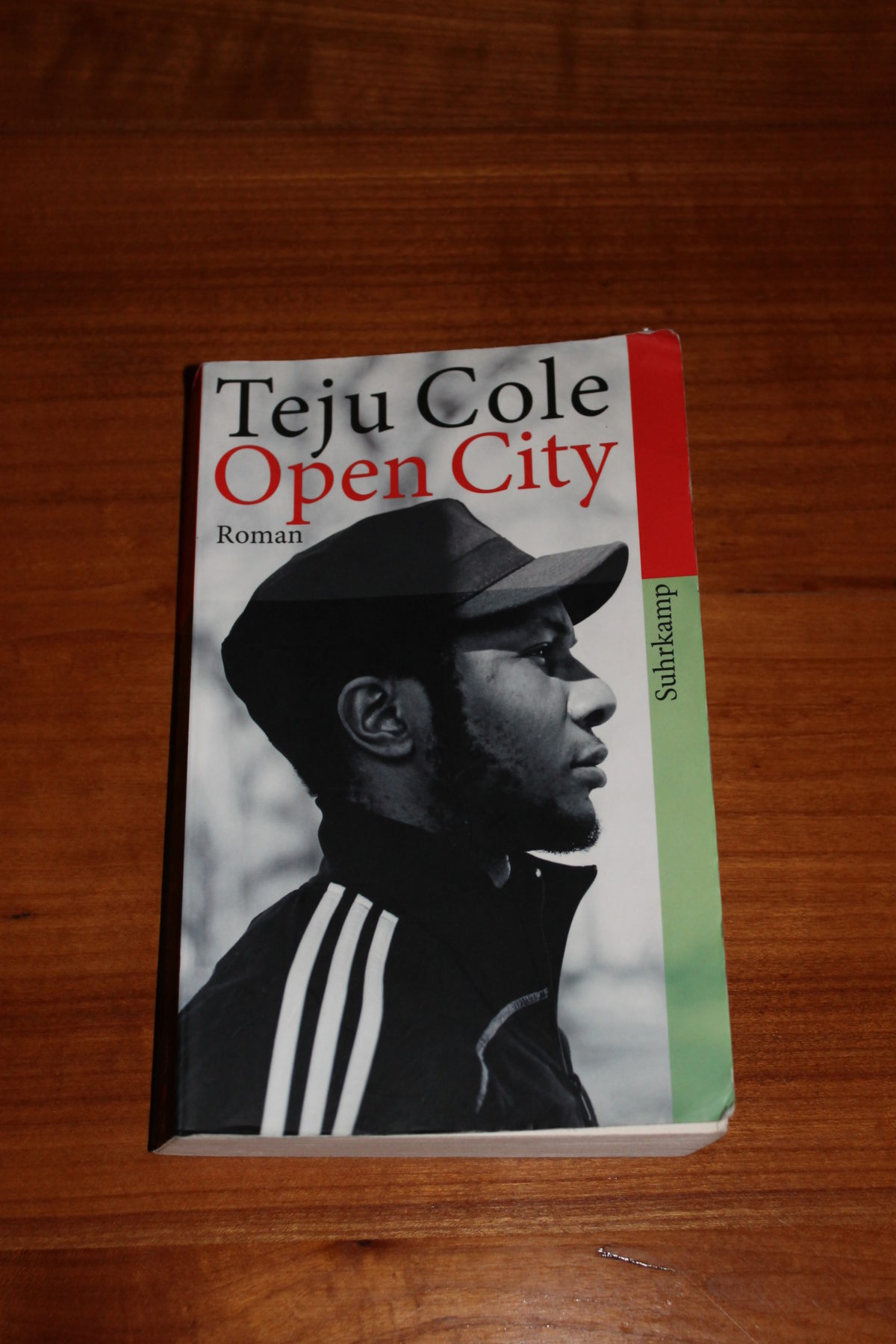Es gibt Bücher, die einen in ihren Bann ziehen, indem sie einem mit verschlungenen Plots, wahnwitzigen Wendungen, rasantem Tempo, nervenzerreissenden Spannungsbögen geradezu bombardieren: Text gewordene Videoclips mit schnellen Schnitten, harten Kontrasten, irren Kamerafahrten.
Solch ein Buch ist der 2011 erschienene Roman „Open City“ nicht. „Open City“ ist, zumindest oberflächlich betrachtet, ein ruhiges, langsames Buch. Eines, in dem auf den ersten Blick nicht allzu viel passiert. Über weite Teile schildert der zweite Roman des amerikanischen Schriftstellers Teju Cole lediglich die Spaziergänge des jungen Psychiaters Julius durch New York City, die dieser nach der Arbeit unternimmt, um in seinem Tagesablauf einen Gegenpol zu seinem strukturierten, exakt reglementierten Arbeitsalltag zu schaffen.
„Die Strassen boten einen willkommenen Ausgleich. Jede Entscheidung – wo ich nach links abbog, wie lange ich gedankenverloren vor einem verlassenen Gebäude stand, ob ich den Sonnenuntergang über New Jersey beobachtete oder durch die Schatten auf der East Side schlenderte und nach Queens hinüberschaute – war letztlich unerheblich und daher eine Erinnerung an Freiheit.“
Lange genug für echte Freiheit scheinen die Spaziergänge nicht zu sein, doch Julius geniesst auch diese Erinnerung an Freiheit. Er zieht seine ziellosen Spaziergänge immer weiter in die Länge und beobachtet dabei seine Umgebung mit einer gedankenvollen Distanz und mit einer gewissen Kälte – fast so, als sei die Stadt um ihn nicht mehr als eine weitere Patientin, die es zu analysieren gälte. Und Cole lässt seinen Protagonisten nicht nur ausgiebig über seine Stadt nachdenken, sondern auch über Kunst, Politik, den Tod, die Gesellschaft, sein Umfeld, sich selbst. Diese zweite Ebene des Beobachtens und Nachdenkens bildet das eigentliche Kapital dieses Buches.
Denn Julius ist ein präziser Beobachter und, vor allem, ein weitschweifiger Denker. Der junge Psychiater denkt stets in grossen und tiefliegenden Zusammenhängen, weiss überall Vergleiche zur Kunst, zur Literatur oder zur Philosophie zu ziehen und katalogisiert die Welt um sich mit dem Blick eines Intellektuellen. Dabei denkt er in wissenschaftlichen, künstlerischen und intellektuellen Kategorien und Denkmustern, weigert sich aber, sich selbst irgendwo einzuordnen. Selbst der eigenen Vergangenheit und Themen wie Rassismus, Einsamkeit oder Herkunft nähert sich Julius fast nur auf einer akademischen, von aussen hereinblickenden Ebene, obwohl ihn diese Dinge direkt betreffen: Er ist der Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen, als Aussenseiter in Nigeria aufgewachsen und erst als junger Erwachsener nach New York gekommen. Eigentlich gute Voraussetzungen, um das Verkopfte zwischenzeitlich mal abzulegen und in Erinnerungen zu schwelgen oder – noch besser – hemmungslos emotional zu werden. Doch das distanzierte, analytische Wälzen von Problemen und Gefühlen scheint ein unkontrollierbarer Reflex von Julius zu sein. Er wirkt dadurch etwas altklug, etwas zynisch und stellenweise so kühl, dass man sich unwillkürlich zu fragen beginnt, ob er mit dieser nüchternen, gebildeten inneren Fassade nicht eine weitere, animalischere Seite seiner Persönlichkeit vor sich selbst versteckt. Und tatsächlich wartet das Buch mit einer dritten, unterschwelligen Ebene auf, die man als Leser nur punktuell und etwas irritiert wahrnimmt, bis sie am Ende des Buchs auf brachiale Weise in den Vordergrund tritt und das Bild zerstört, das wir uns von Julius gemacht haben.
Diese dritte Ebene von „Open City“ wird vor allem über die wenigen anderen Charaktere transportiert, die in dem Roman neben Julius vorkommen. An ihnen kann man, wenn man will, auch eine der wenigen Schwächen des Buches festmachen: Neben dem übergrossen Ego des Ich-Erzählers wirken die restlichen Personen etwas funktional und farblos. Der sterbende altersmilde Professor, der religiöse Schuhputzer, der hochintelligente Marokkaner, der an der Uni gescheitert ist und jetzt seinen Hass auf Israel kultiviert – sie alle sind zwar glaubhaft beschrieben und könnten durchaus reale Vorbilder haben. Doch mitunter wird man den Eindruck nicht los, dass sie die seitenlangen Gedankengänge des Erzählers nur deshalb unterbrechen dürfen, weil sie die perfekten Stichwortgeber für weitere Seiten voll grosser Gedanken sind, die sich aneinanderreihen, bis Julius – oder Teju Cole – uns seine gesamte Weltsicht in all ihren Details und Verästelungen erklärt hat. Ich für meinen Teil pendelte nach dem Fertiglesen jedenfalls zwischen Erschöpfung und Bewunderung für die unbestreitbare Klugheit, die einem aus diesem Buch entgegenspringt. Und habe es dann ein paar Wochen später nochmals gelesen. Und pendle immer noch. Wobei: In seinen Bann gezogen hat mich das Buch, auch ohne irre Kamerafahrten und den ganzen restlichen Krempel.
Deutsch: Teju Cole, Open City, Suhrkamp 2013, aus dem amerikanischen Englisch von Christine Richter-Nilson, ab 17.00 CHF
Englisch: Teju Cole, Open City, Random House New York, 2011
„Open City“ erhielt nebst anderen Auszeichnungen 2013 den Internationalen Literaturpreis vom Haus der Kulturen der Welt und der Stiftung Elementarteilchen.
Teju Cole, Sohn nigerianischer Eltern, kam in den USA zur Welt. Er verbrachte den Grossteil seiner Kindheit und Jugend in Lagos, Nigeria und kehrte erst im Alter von 17 Jahren in die USA zurück. Er lebt in Brooklyn. Von Juni bis November 2014 wohnte Teju Cole als Writer in Residence des Literaturhauses Zürich in der Limmatstadt und schrieb dort unter anderem Artikel für Das Magazin des Tagesanzeigers.