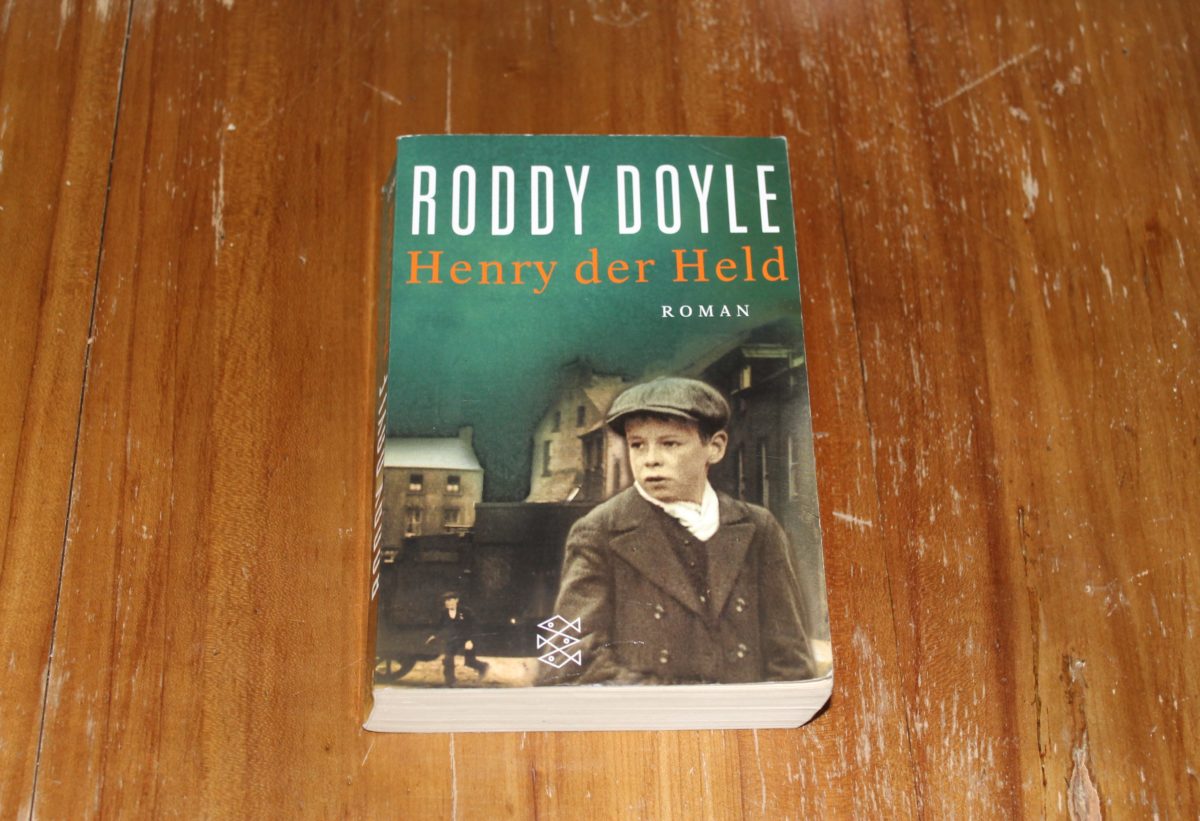A Star called Henry (dt. Henry der Held) ist bereits der sechste Titel des irischen Schriftstellers Roddy Doyle. Der Roman ist brechend voll mit gut recherchierten Anekdoten und Infos zur Geschichte und zur Kultur der Stadt. Aber auch rammelvoll mit zwielichtigen Gestalten, die einen als Leser unter Umständen zweifelnd zurücklassen.
1906. Melody sitzt auf dem Treppenabsatz vor dem Eingang zu einem stinkenden, überfüllten Mietshaus in Dublin und schaut in den Nachthimmel. In dem dünnen Streifen, den sie von ihrem Sitzplatz aus sehen kann, sucht sie mit dem Zeigfinger unsicher hin und her, bis sie sich sicher ist. „Das ist er“, sagt sie. „Das ist Henry.“
Er, der andere Henry, sitzt daneben und fühlt sich unerwünscht, übersehen, zurückgestossen. „Ich bin doch auch noch da! Was ist mit miiiir???“ Er hasst Henry, den Stern. Und bemitleidet seine Mutter: „Melody Nash. Ich denke an ihren Namen und sehe nicht meine Mutter vor mir. Melody, die Melodie. Sie hüpft, sie lacht, die schwarzen Augen leuchten (…). Wie alt war sie, als ihr die Wahrheit aufging, als sie begriff, dass in ihrem Leben keine Musik spielte? Dass der Name Lüge war, ein böser Hexenzauber?“
Man weiss es nicht. Über Melody weiss man nur, dass sie zwölf war, als sie in Mitchells Rosenkranzfabrik zu arbeiten begann und sechzehn, als sie Henry Smart über den Weg lief, dem sturzbetrunkenen Einbeinigen. Ein Dockarbeiter, Türsteher, Schwindler, Schläger, Auftragskiller. Ausserdem bald nach dem Zusammentreffen mit Melody der Vater beider Henrys.
Über Melody weiss man noch, dass sie den ersten Henry verloren hat: Henry, wie der Vater, Henry, ihr erster Sohn, Henry, der doch ihr gemeinsames Glück sein sollte, ihr Ticket aus den Slums raus, irgendwie. Henry, der Traum. Wie es sich für Träume in den Elendsvierteln von Dublin gehört, hat er nicht mal seine Geburt überlebt.
Also hat Melody seinem Namen einen Stern gegeben und den sucht sie jeden Abend, während sie auf dem Treppenabsatz vor ständig wechselnden Mietshäusern hockt, während das Elend und die Trauer und der Alkohol sie in die Breite quellen lassen und ihr die letzten Zähne aus dem Mund faulen. Als ihr zweiter Sohn gesund zur Welt kommt, ist sie noch keine 20 und schon unaufhaltsam am zerfallen.
Ihr Mann, der einbeinige Henry, an dessen Mantel das Blut der halben Stadt klebt, bricht ihr das letzte bisschen Herz, als er darauf besteht, auch seinen zweiten Sohn Henry zu taufen. So kommt Henry, der Übersehene, zu seinem Namen. Und zur Einsicht, dass ihm in diesem Leben nichts geschenkt werden wird. Sogar die verdammten Sterne machen ihm den Platz streitig.
Von der Treppe zum (Anti)helden
Er ist gerade fünf Jahre alt, als er den jüngeren Bruder bei der Hand nimmt und die kaputte Mutter mit den anderen Geschwistern auf der Kellertreppe zurücklässt, um sein eigenes Glück zu machen. Von nun an leben die zwei Brüder auf der Strasse. Dort brodelt es. Die Bevölkerung will sich von der Fremdherrschaft aus London befreien, denn Irland ist zu dieser Zeit in den Augen vieler Dubliner nicht mehr als eine arme englische Kolonie. Gerade gut genug, billige Arbeitskräfte zu liefern und Soldaten als Kanonenfutter für die Kriege des Empire. Doch Henry ist schon als Fünfjähriger hart, unerschrocken und erfinderisch. Und er hat Charme. Dank diesem gelingt es ihm sogar, für sich und seinen Bruder einen Platz an einer Schule zu erkämpfen.
Knapp ein Dutzend Jahre später hat Henry Lesen und Schreiben gelernt und ist auf den ersten Blick zum Vorzeige-Dubliner geworden: Geradlinig, mutig, smart, trinkfest, tanzfreudig, loyal. Ein Riese von einem Mann. Dann gibt es da noch diese ungestüme junge Lehrerin, die er liebt. Und Henry ist jetzt ein Killer im Auftrag der IRA.
Wie es dazu kommt, beschreibt der Doyle in seinem sechsten Roman schonungslos, aber auch so mitreissend, dass man das Buch keine Sekunde lang weglegen möchte. Durch die Augen des aufwachsenden Henry ist man bei den ersten grösseren Streiks in Dublin mit dabei, erlebt die hitzige Atmosphäre in den Pubs der Widerständler und schliesslich an vorderster Front die Osteraufstände von Dublin 1916. Diese sollten den Startschuss für eine irische Revolution bilden, aber das Vorhaben scheiterte aufs Blutigste. Wer von den Aufständischen die militärische Gegenreaktion überlebte, wurde verhaftet, einige der Inhaftierten wurden später hingerichtet. Nur wenigen gelang die Flucht in den Untergrund.
Henry schildert all das in der Ich-Perspektive und konzentriert sich nicht nur die grossen historischen Ereignisse. Mindestens ebenso wichtig sind ihm die Geschichten über seine Familie und jene Menschen in der IRA, die er für Freunde hält. Und dann war da doch noch die Sache mit dieser ungestümen jungen Lehrerin, für die er, mehr oder weniger wortwörtlich, durchs Feuer gehen würde. Tatsächlich kann man „Henry der Held“ nicht nur als historischen Roman lesen, sondern auch als Liebesgeschichte.
Wo wir gerade bei Deutungsmöglichkeiten und Liebesgeschichten sind: Alternativ kann man „Henry der Held“ auch als lange Liebeserklärung an Dublin lesen, obwohl die Stadt im Buch auf den ersten Blick nicht gut wegkommt und vor allem ihre hässlichen Seiten beschrieben werden. Aber wenn ein Dubliner über seine Stadt sagt, sie sei hässlich, meint er eigentlich, dass er sie liebt. Was den Humor angeht, sind die Iren dann eben doch Briten.
Darf man Henry eigentlich mögen?
Doyle hat mit Henry eine sehr ambivalente Figur geschaffen. Henry ist ein Macher, bodenständig bis zum geht nicht mehr. Er ist einer, der sich nichts aus Politik macht und der sich eher wegen der warmen Mahlzeiten und dem Dach über dem Kopf dem Widerstand angeschlossen hat. Einer, mit dem man eigentlich gern ins Pub um die Ecke auf ein paar Bier gehen würde, weil er gut Geschichten erzählen kann.
Aber dann ist da noch der andere Henry. Jener, der ohne mit der Wimper zu zucken Leute um die Ecke bringt. Endgültig um die Ecke, nicht bloss ins nächste Pub. Das stimmt nachdenklich, wenn man sich bewusst macht, dass es die Killerkommandos der IRA wirklich gegeben hat und dass unter ihren Mitgliedern vielleicht auch Leute wie Henry waren. Junge Kerle, die man eigentlich mögen will.
Doyle lässt Henry die Geschichte in seinen Worten erzählen und was Henry erzählt ist inhaltlich und in der Wortwahl öfter mal brutal und vulgär. Ausserdem übertreibt er an allen Ecken und Enden hemmungslos, eben so, als würde er die Geschichte in einem Pub zum Besten geben. Daran kann man sich stossen, muss man aber nicht. Immerhin ist es ja auch die Geschichte eines Strassenjungen.
Englisch: „A Star called Henry“, 1999, Jonathan Cape.
Deutsch: Henry der Held, dt. von Renate Orth-Guttmann, Frankfurt am Main, Krüger 2000. ISBN 3-8105-0444-0. Ab ca. 15.00 CHF, 408 Seiten.